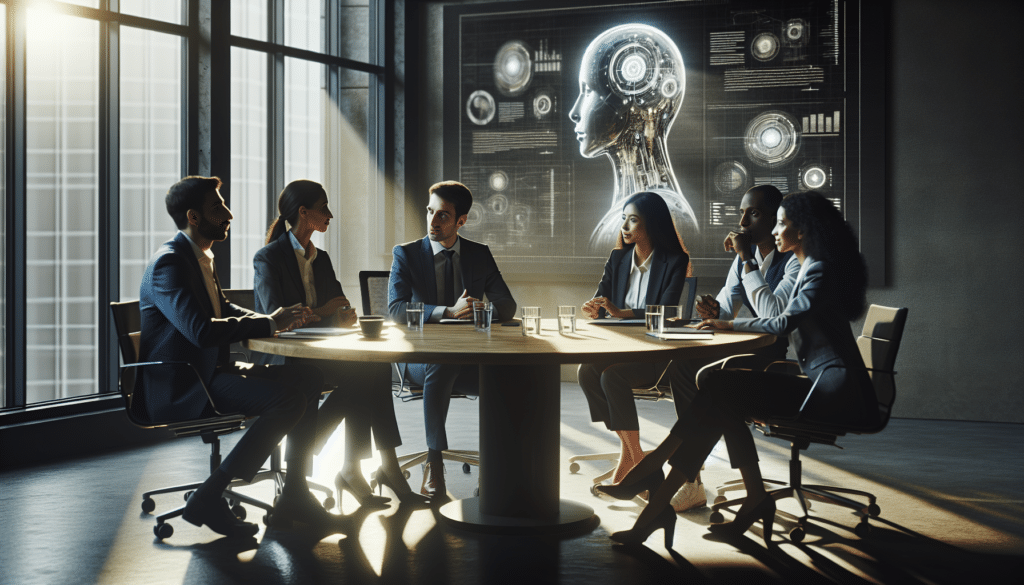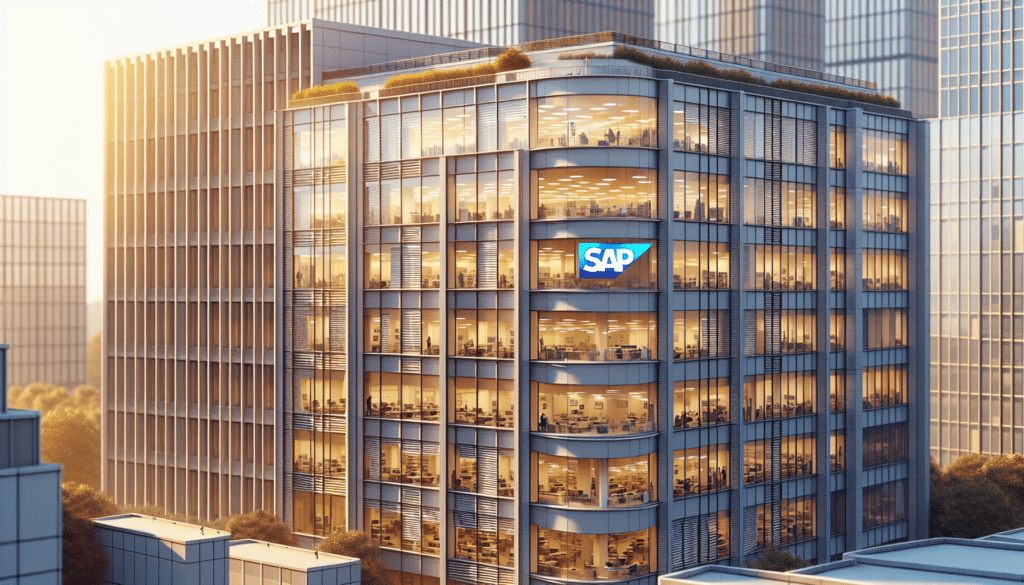Wie gelingt es Unternehmen, KI nicht nur als technische Spielerei, sondern als festen Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie zu etablieren? Diese Frage treibt viele Führungskräfte um, denn die Mehrheit der KI-Projekte bleibt oft in der Konzeptphase stecken. Der Schlüssel liegt in einer klaren Strategie, die bereichsübergreifende Zusammenarbeit, klare Verantwortlichkeiten und einen klar definierten Geschäftsnutzen umfasst. In diesem Beitrag wird beleuchtet, wie Führungskräfte den Wandel gestalten können – von Use-Case-Auswahl über Plattform und Governance bis zu messbarer Wirkung und Kultur.

Die POC-Falle im Blick
Viele Unternehmen starten heute mit ambitionierten KI-Initiativen – doch eine beängstigende Zahl solcher Projekte bleibt in der Experimentierphase stecken. Laut einer aktuellen Studie von Lünendonk können lediglich etwa 30 Prozent der Firmen mehr als ein Viertel ihrer KI-Prototypen überhaupt in den produktiven Betrieb überführen. Die Gründe liegen weniger in technischen Herausforderungen als in organisatorischen Barrieren, mangelhafter Datenqualität und fehlendem Change-Management.
IT- und Businessverantwortliche gaben an an, dass die Hauptgründe für das Scheitern nicht in der Technologie liegen, sondern in schlecht gestalteten Prozessen, unklaren Verantwortlichkeiten, isoliert arbeitenden Teams und unrealistischen Erwartungen. Dieser Befund unterstreicht die Notwendigkeit, über einzelne Proof-of-Concepts hinauszudenken – und eine tragfähige KI-Strategie zu etablieren, die Skalierung ermöglicht. Das bedeutet auch: Führungskräfte müssen bereits beim Pilotdesign die Weichen für langfristige Skalierbarkeit stellen – mit klarer Struktur, Domänenintegration und umfassender Governance.
Use-Case-Portfolio: vom Einzelprojekt zur strategischen Auswahl
Ein bewährter Ansatz zur Skalierung ist der Aufbau eines Use-Case-Portfolios, statt wild zahlreiche einzelne Projekte zu starten.
- Wirtschaftlicher Nutzen: Steigert die Lösung Umsatz, senkt sie Kosten oder verbessert sie Qualität?
- Umsetzbarkeit: Gibt es genügend Daten, technische Machbarkeit und Stakeholder-Unterstützung?
- Risiko & Regulierung: Welche regulatorischen Anforderungen gelten (z. B. EU AI Act)?
Erfolgreiche Strategien kombinieren kurzfristige Effizienzprojekte wie Prozessautomatisierung mit wachstumsorientierten Cases wie personalisierten Services sowie einigen innovativen Moonshots, die Differenzierung schaffen.
Unternehmen, die bereichsübergreifende Zusammenarbeit fördern, skalieren ihre Projekte deutlich erfolgreicher. Klar definierte Verantwortlichkeiten und ein eindeutiger Business Case gelten als kritische Erfolgsfaktoren.
Daten und Plattform als stabile Basis
Der Sprung von PoC zu Produktivbetrieb gelingt nur, wenn die Dateninfrastruktur tragfähig ist.
- Datenqualität & Governance: Einheitliche Standards, klare Verantwortlichkeiten, Metadatenkataloge und Schutz sensibler Daten
- KI-Plattform & Tools: Modellregistrierung, Prompt-Management, Monitoring, Versionierung und Evaluationspipelines
- Sicherheits- und Kontrollmechanismen: Datenzugriffsregeln, DLP, Red-Team-Tests und Audit-Trails
Gerade in größeren Organisationen können heterogene Datenlandschaften und Silos die Skalierbarkeit blockieren – eine gut durchdachte Plattformarchitektur ist hier Schlüssel.
Operating Model und Rollen – wer trägt was?
Für eine erfolgreiche Skalierung bewähren sich Modelle wie Hub and Spoke.
- Ein zentrales AI Center of Excellence (CoE) koordiniert Methoden, Standards, Onboarding, Governance und Wissenstransfer
- Domänenteams aus Fachbereichen wie Vertrieb, Produktion oder HR realisieren und betreiben Use Cases
- Plattform- und Infrastructure-Teams kümmern sich um Tools, Sicherheit und Monitoring
Neue Rollen sind essenziell: Chief AI Officer, AI Product Owner, Prompt Engineer, AI Risk Officer. Führungskräfte müssen klare Rollen und Schnittstellen definieren, damit es nicht zur Verantwortungsdiffusion kommt.
Governance und Compliance – angesichts des AI Act
Mit dem Inkrafttreten des EU AI Act stehen Unternehmen unter zusätzlichem Regulierungsdruck. Systeme müssen je Risikoklasse klassifiziert, dokumentiert und überwacht werden. Transparenzpflichten, Post-Market Monitoring und Human Oversight sind zentral.
Praxisrelevante Standards und Frameworks helfen:
- ISO/IEC 42001 für KI-Managementsysteme: Rollen, Prozesse und kontinuierliche Verbesserung
- NIST AI Risk Management Framework (AI RMF): Schritte zur Identifikation, Messung und Steuerung von Risiken
Eine pragmatische Governance sollte strategische Richtlinien, prozessuale Checklisten und technische Schutzmechanismen kombinieren. So lassen sich regulatorische Vorgaben erfüllen, ohne Innovation zu blockieren.
Menschen, Kultur und Change: der Katalysator der Adoption
Selbst die beste Technik bleibt wirkungslos, wenn Menschen sie nicht annehmen.
- AI-Literacy fördern: Schulung aller Ebenen zu Nutzen, Grenzen, Risiken
- Power-User & Communities: Experten fördern, Best Practices teilen
- Partizipation & Transparenz: Stakeholder von Anfang an einbinden – auch Betriebsrat, Compliance, Datenschutz
- Kulturelle Offenheit: Fehlerfreundlichkeit, Lernbereitschaft und Experimentierfreude fördern
Mangelndes Change Management zählt zu den Hauptgründen, warum KI-Initiativen scheitern. Wer hier investiert, spart später Zeit und Widerstände.
Erfolg messbar machen – vom Pilot zum Business Impact
Für Führungskräfte ist ein belastbares KPIsystem Pflicht.
- Produktivität: Zeitersparnis, Automatisierungsgrad
- Umsatzbeiträge: Conversion, Personalisierungserfolge
- Qualität: Fehlerquote, Kundenzufriedenheit
- Compliance & Risiko: Audit-Ergebnisse, Sicherheitsvorfälle
- Adoption: aktive Nutzer, Time-to-Value
Regelmäßige Reviews ermöglichen, schwache Projekte zu stoppen und erfolgreiche Ansätze zu skalieren.
90-Tage-Plan: vom Plan zum Einstieg mit Rückenwind
- 0–30 Tage: Analyse laufender POCs und Bewertung des Reifegrads, Priorisierung von Use Cases mit hoher Wirkung und Umsetzbarkeit, erste Governance-Richtlinien definieren
- 31–60 Tage: Aufbau der Plattform-Grundlagen, Gap-Analyse zum AI Act und ISO 42001, Standardisierung der Pilot-Playbooks
- 61–90 Tage: Mindestens ein bis zwei Use Cases produktiv ausrollen, KPI-Dashboard implementieren, Compliance-Roadmap für Risikoklassen fixieren
Fazit: Führung mit Blick auf Realisierung und Nachhaltigkeit
Viele KI-Projekte verharren im Experimentierstadium, weil organisatorische und kulturelle Faktoren vernachlässigt werden. Für Entscheider bedeutet das: Es reicht nicht, einzelne Anwendungsfälle zu genehmigen. Es braucht eine klare Use-Case-Strategie, ein belastbares Daten- und Plattformfundament, ein geordnetes Operating Model mit definierten Rollen, Governance und Compliance, die mitwachsen, Kultur und Change, die Menschen mitnehmen, sowie ein KPIsystem, das Wirkung misst.
Wenn das gelingt, wird KI mehr als Technologie – sie wird zum strategischen Hebel für Wachstum, Effizienz und Innovation. Und Unternehmen, die diesen Schritt konsequent gehen, sichern sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in der KI-Ära.