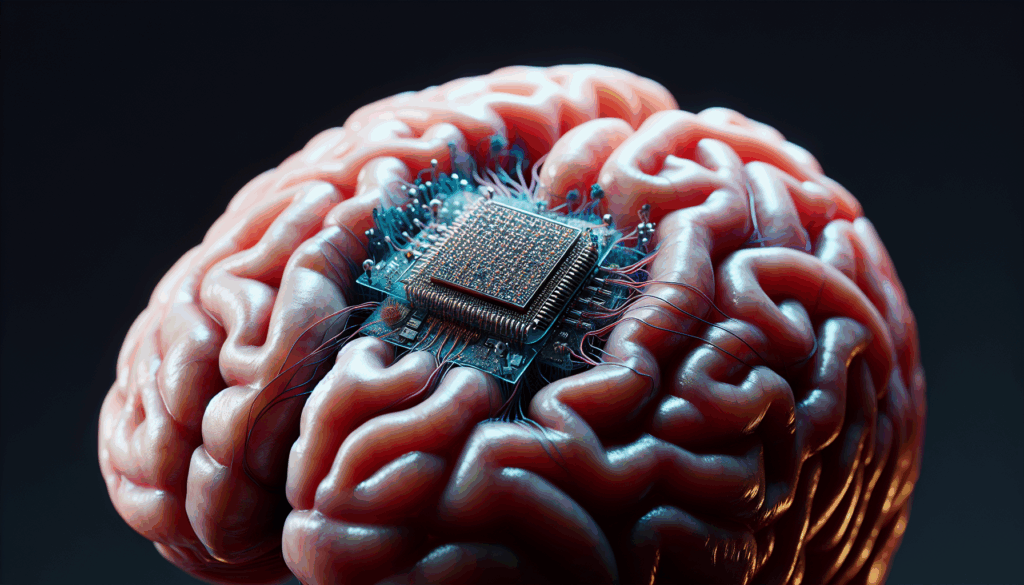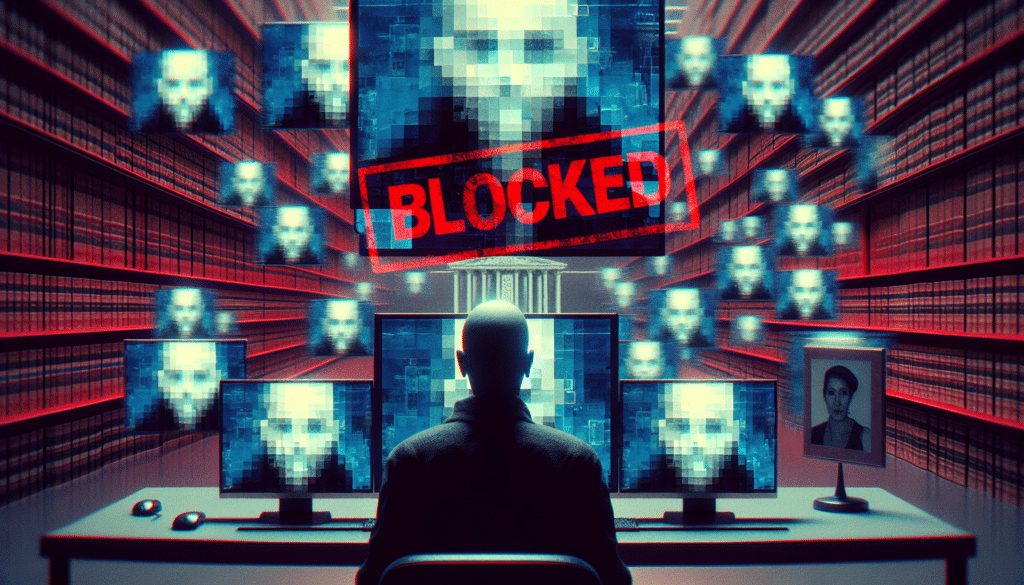Was bleibt von einem Menschen, wenn er stirbt? In der Ära der Künstlichen Intelligenz wird diese Frage nicht nur philosophisch, sondern technologisch greifbar. Immer mehr Entwickler nutzen KI, um digitale Versionen Verstorbener zu erschaffen – mit Stimmen, Mimik und Erinnerungen. Doch was als emotionale Stütze gedacht ist, wirft gravierende ethische und rechtliche Fragen auf.

Die Vision der digitalen Unsterblichkeit
Die Vorstellung, das menschliche Leben über den physischen Tod hinaus zu verlängern, hat seit jeher die Menschheit fasziniert. Die digitale Unsterblichkeit durch KI ist ein modernes Konzept, das diese Idee aufgreift und versucht, sie durch technologische Innovationen in die Realität umzusetzen. Im Kern geht es darum, Erinnerungen, Persönlichkeit und sogar das Wesen eines Menschen digital zu konservieren. Dadurch könnten Nachkommen und Freundinnen und Freunde auch nach dem Tod der Person auf deren Wissen und Erfahrungen zugreifen. Doch wie funktioniert das genau? Welche Technologien kommen zum Einsatz, und welche ethischen Fragestellungen werfen sie auf?
KI-Avatare Verstorbener: Was technisch bereits möglich ist
Mit Hilfe von Videomaterial, Textnachrichten, Tonaufnahmen und maschinellem Lernen entstehen sogenannte griefbots – digitale Avatare, die das Verhalten Verstorbener nachahmen. In einem Bericht der New York Post schildern Entwickler, wie sie aus Interviewaufnahmen, Biografien und KI-generierten Stimmen eine Art „Robo-Dad“ erschaffen haben – ein Vater, der Jahre nach seinem Tod wieder mit seinen Kindern „spricht“.
Eine neue Dimension erreichte dieses Thema, als der US-amerikanische Journalist Jim Acosta am 5. August 2025 ein Interview mit dem KI-generierten Avatar von Joaquin Oliver führte – einem der Jugendlichen, die 2018 beim Amoklauf an der Marjory Stoneman Douglas High School in Florida getötet wurden. Das Gespräch wurde auf Substack veröffentlicht und löste unmittelbar weltweit Debatten aus.
Das Interview: „I was taken from this world too soon…“
Die Avatargestalt von Joaquin antwortete auf Acostas erste Frage „What happened to you?“ mit den Worten: „I was taken from this world too soon due to gun violence while at school.“ Die Stimme war künstlich, die Bewegungen leicht verzögert – und dennoch wirkten die Antworten für viele Zuschauer emotional beklemmend echt.
Das Interview wurde von Joachins Eltern initiiert und unterstützt, insbesondere von seinem Vater Manuel Oliver, der mit der Kampagne „Change the Ref“ politische Aufmerksamkeit auf die lasche US-Waffengesetzgebung lenken will. Ziel war, Joachins Stimme im Kampf gegen Waffengewalt weiterleben zu lassen. Doch genau das stößt auf massive Kritik.
Zwischen Erinnerungskultur und emotionaler Manipulation
Solche Anwendungen bewegen sich in einem emotional hoch aufgeladenen Feld. Befürworter argumentieren, dass KI-Avatare helfen können, Trauer zu bewältigen – ähnlich wie Fotos oder Tagebücher. Gegner hingegen warnen vor einer Verzerrung der Realität, emotionaler Ausbeutung und dem Verlust der natürlichen Trauerprozesse.
„Was bedeutet Zustimmung, wenn jemand nicht mehr lebt?“ fragt sich die Guardian-Kolumnistin Gaby Hinsliff. In ihrer Analyse kritisiert sie das KI-Interview mit Joaquin als Grenzüberschreitung und warnt vor einer „Normalisierung der digitalen Wiederbelebung“, die weitreichende Konsequenzen für Ethik, Identität und gesellschaftliche Werte habe.
Rechtliche Grauzonen und regulatorische Leere
Aktuell gibt es kaum verbindliche gesetzliche Grundlagen zum digitalen Nachleben. In Europa schützt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nur lebende Personen. Persönlichkeitsrechte enden in der Regel mit dem Tod – es sei denn, Hinterbliebene pochen auf das postmortale Persönlichkeitsrecht oder Urheberrecht. Doch KI-generierte Avatare basieren oft auf Datenspuren, deren Nutzung nie ausdrücklich erlaubt wurde.
Auch die Frage nach der Urheberschaft solcher digitalen Abbilder ist ungeklärt. Wer „besitzt“ ein KI-generiertes Abbild eines Verstorbenen? Die Familie, der Entwickler, oder das trainierte Modell selbst? Diese Unsicherheiten rufen Datenschutzbeauftragte, Ethikräte und KI-Regulatoren zunehmend auf den Plan.
Die Rolle der Medien und Entwickler
Besonders kritisch ist die Rolle des Journalismus, wenn er solche Technologien für Interviews oder Dokumentationen nutzt. Das durchgeführte Gespräch von Jim Acosta mit der KI-Version von Joaquin Oliver wird von vielen als ethischer Tabubruch gewertet – auch wenn es von den Eltern autorisiert wurde. Die Frage bleibt: Dient ein solches Interview wirklich der Aufklärung – oder ist es eine Form der emotionalen Instrumentalisierung?
Auch Entwickler von KI-Systemen stehen in der Verantwortung. Ohne klare ethische Leitplanken droht ein kommerzieller Markt für digitale Wiederbelebung – von „Unsterblichkeitsservices“ bis hin zu personalisierten Chatbots aus dem Jenseits.
Ausblick: Was erlaubt sein sollte – und was nicht
Was heute technisch möglich ist, darf nicht automatisch gesellschaftlich akzeptabel sein. Die Diskussion über KI und digitale Unsterblichkeit steht erst am Anfang. Es braucht klare Rahmenbedingungen, die Fragen von Zustimmung, Datenverwendung, psychologischer Wirkung und wirtschaftlichem Interesse beantworten.
Ein Weg könnte darin bestehen, ethische Mindeststandards für KI-Avatare Verstorbener zu entwickeln – vergleichbar mit medizinethischen Leitlinien. Dabei sollten auch Fragen der Repräsentation, des emotionalen Schutzes Hinterbliebener und der Verantwortung von Medienschaffenden eine zentrale Rolle spielen.
Die digitale Wiederbelebung Verstorbener mit KI ist keine Science-Fiction mehr – sondern Realität. Doch die ethischen und rechtlichen Grundlagen hinken hinterher. Zwischen Trost und Tabubruch, Erinnerung und Manipulation verläuft eine dünne Linie. Es liegt an uns, wie wir mit dieser neuen Form von „Unsterblichkeit“ umgehen – und welche Werte wir in der digitalen Ewigkeit bewahren wollen.